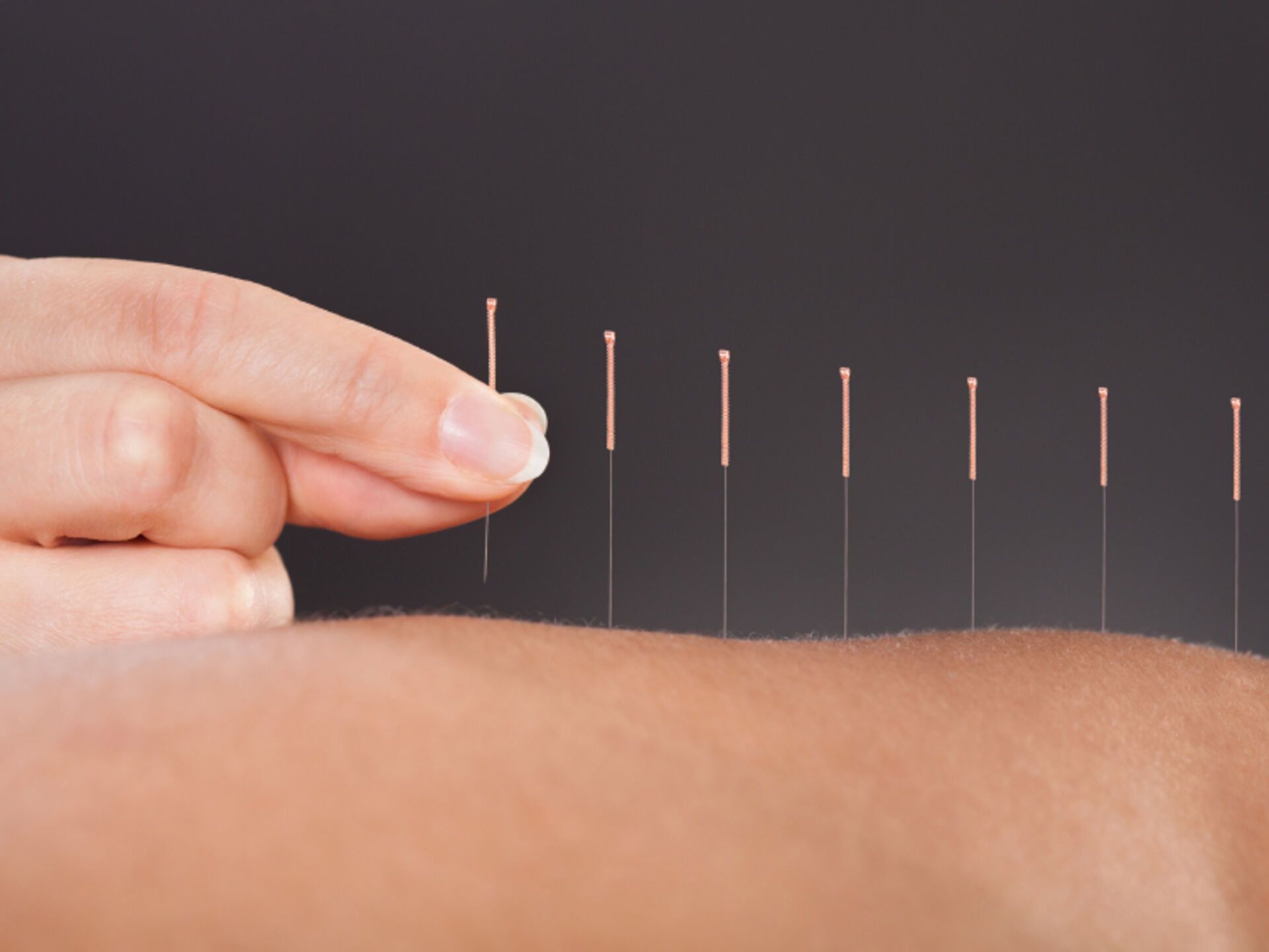Fantasie setzt Wissen voraus
Nein, sind sie nicht. Entgegen gängigen Behauptungen.
Fantasie setzt nämlich das Verständnis von Symbolen voraus, also, dass etwas stellvertretend für eine andere Sache stehen kann. Fantasie setzt Wissen voraus. Erst wer schon eine Piratin im Bild gesehen hat, kann sie sich später vorstellen und das Kostüm entsprechend stylen. Fantasie setzt die Kenntnis von Regeln voraus.
Einen imaginierten Drachen in einem Kissen-Gefängnis einlochen kann nur, wer die Regel kennt, dass der als Drachen fungierende Teddy nicht doch plötzlich Feuer speien wird. Erst ab etwa zwei Jahren sind Kinder dazu in der Lage. Von jetzt an ist das kreative Fantasiespiel Trumpf, entwickelt sich weiter und weiter und mit ihm das Kind. Und die buntesten Blüten treibt die Vorstellungskraft bei Mädchen und Jungen, mit, wie es im Pädagog* innen-Jargon heisst, «sicherer Elternbindung», die wissen: «Ups, schiefgegangen? Macht nix. Mama und Papa sind ja da.»
Gut auch, wenn Erwachsene sensibel genug sind, zu sehen, was sie ist, diese spezielle Sache, für die das Kind glüht, und entsprechende Angebote machen. Hätte Mozart den Fussball und Ronaldo die Geige bekommen, wer weiss, ob wir die beiden überhaupt kennen würden. Oder wenn ihr Umfeld auf ihr Talent reagiert hätte, wie Einsteins Kindermädchen auf Klein-Albert. Das nämlich soll den Jungen für beklagenswert deppert gehalten haben, lungerte er doch ganze Tage auf der Couch herum und sinnierte über die Ausrichtung einer Kompassnadel. Glücklicherweise scheint die Einschätzung des Kindermädchens Einstein nicht nennenswert irritiert zu haben, und er nahm sich weiterhin Zeit zum Chillen.
Denn nur beim vermeintlich faulen Abhängen, schildert Ulrich Schnabel in seinem Buch «Muße», entsteht jener kreative Raum, «unser Gehirn in sich selber spazieren gehen zu lassen», Gelerntes zu verarbeiten, neue Zusammenhänge herzustellen und im besten Fall – Heureka! – einen zündenden Einfall zu haben. Wenn, ja wenn, man dabei nicht gestört wird. Das kommt selten vor. Länger als drei Minuten, so Gloria Mark von der University of California, bleibt heutzutage kaum jemand bei der Sache.
Ploppt hier eine Mail auf, wird da kurz das Smartphone gecheckt. Tendenz auch bei Kindern und Jugendlichen: steigend. Wo es blinkt und flirrt und sirrt wie in einem Flipperkasten, zersplittern Ideen. Sind Unterbrechungen Programm, entsteht kein fertiges Produkt. Medialer Overkill und Zerstreuungsangebote von allen Seiten machen es überflüssig, sich selbst etwas auszudenken.
Gehirne sind bequem. Und – sie werden bequem gemacht. Denn eine mal unbequeme Frage, die man sich in einem stillen Stündchen stellen könnte: Wie ernst ist es uns Eltern und Erwachsenen tatsächlich mit der Kreativität bei Kindern? Heisst die ehrliche Antwort nicht oft: ähm, nicht so. Weil dieses ständige Wieso-weshalb-warum-Fragen nervt?
Im Schulsystem halt doch die Artigsten, denen die vier vorgesehenen Antwortzeilen fürs auswendig Gelernte reichen, am weitesten kommen? Weil überhaupt beunruhigend britzelnde Ideen ungemütlicher sind als behagliche Gruppenveranstaltungen zum Mitklatschen?
Okay.
Dann reichen Mandalas und jeden Oktober Kastanienmännchen-Basteln nach Vorlage.
Nur eben: Neues entsteht so niemals, und – Glück seltener. Denn, auch das beweisen Studien, langfristig glücklicher sind Menschen, die sich trauen, vergnügt aus der Reihe zu tanzen. Wahrscheinlich, weil ausserhalb der Reihe viel mehr Platz ist zum Tanzen. Mit nie dagewesenen Schritten.